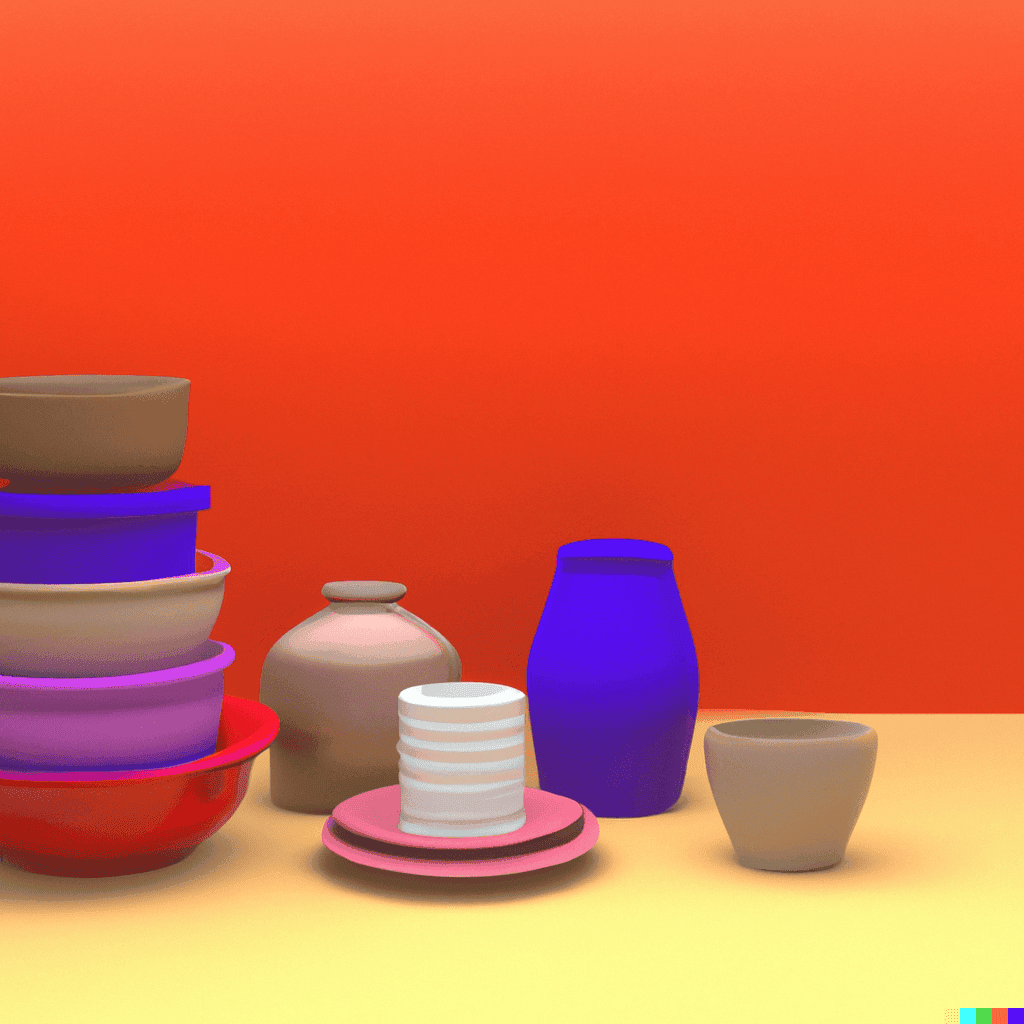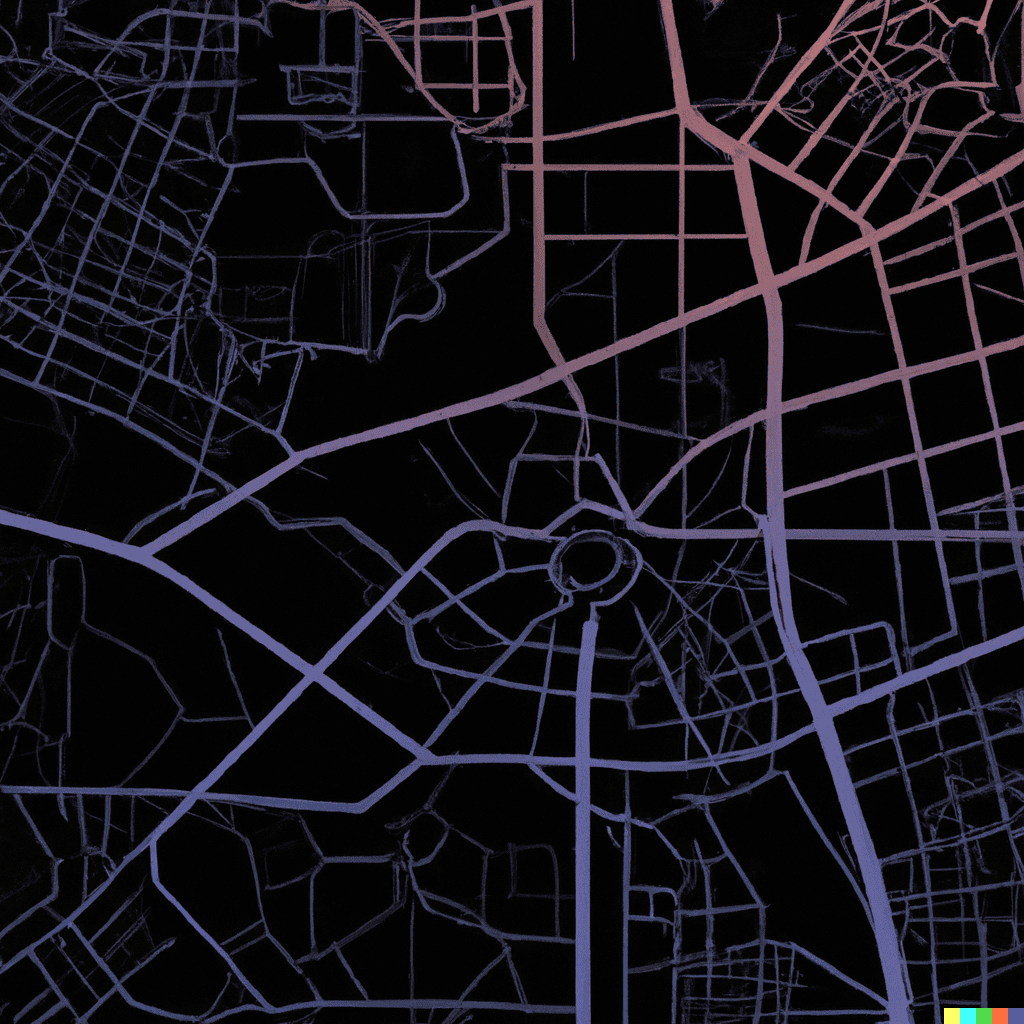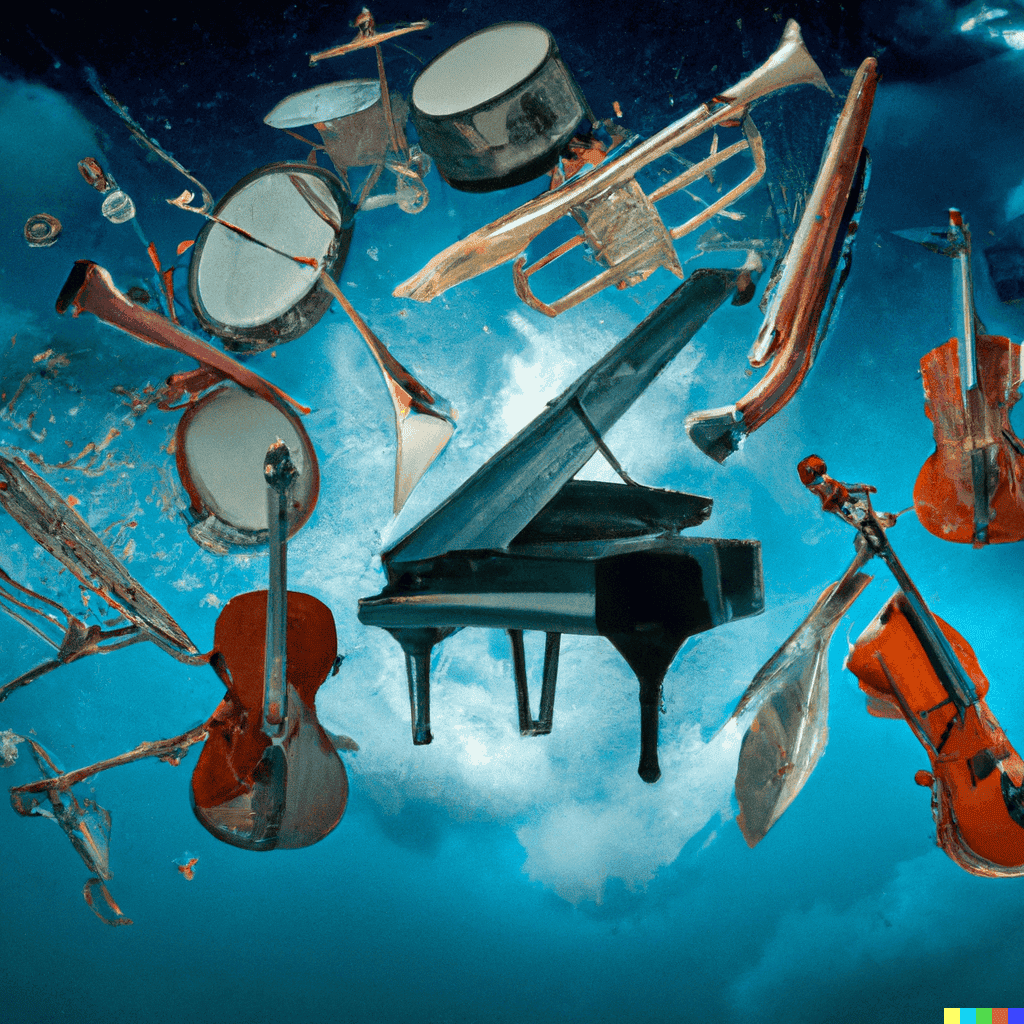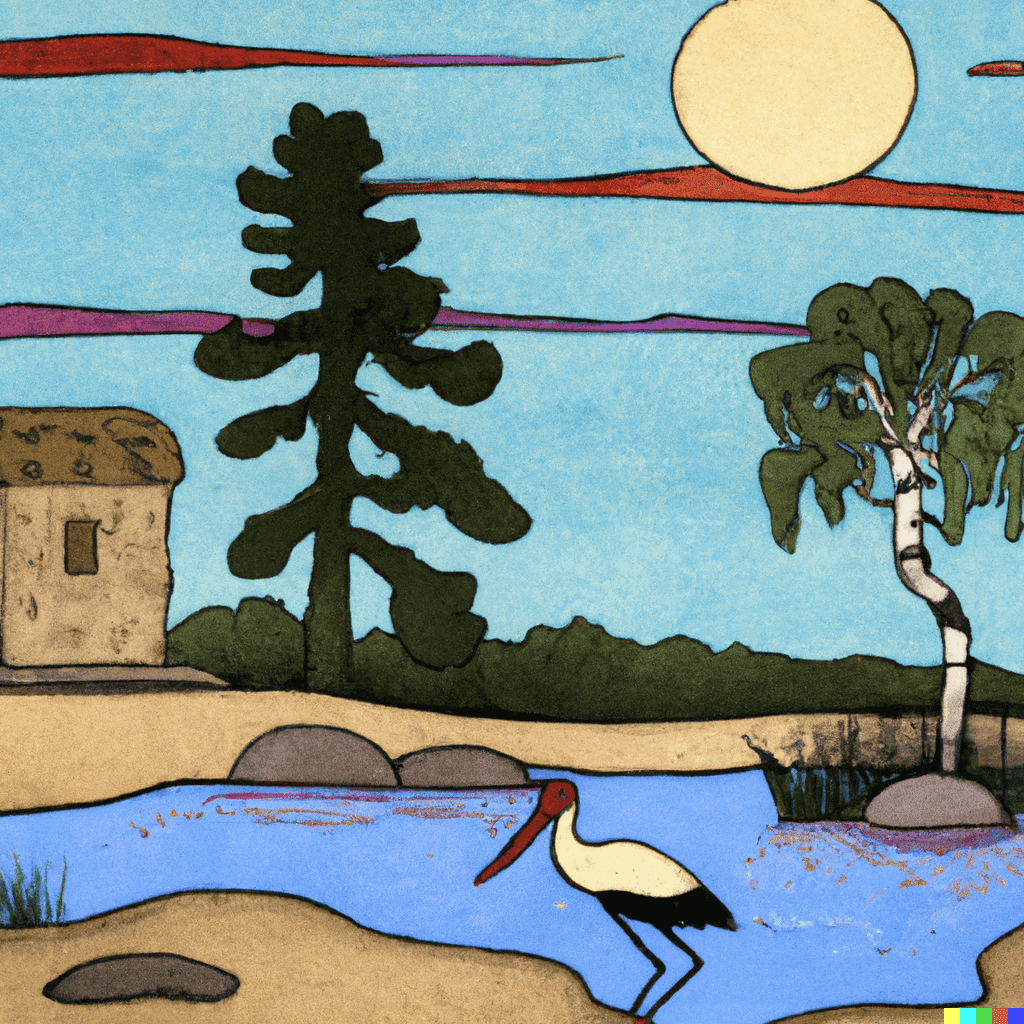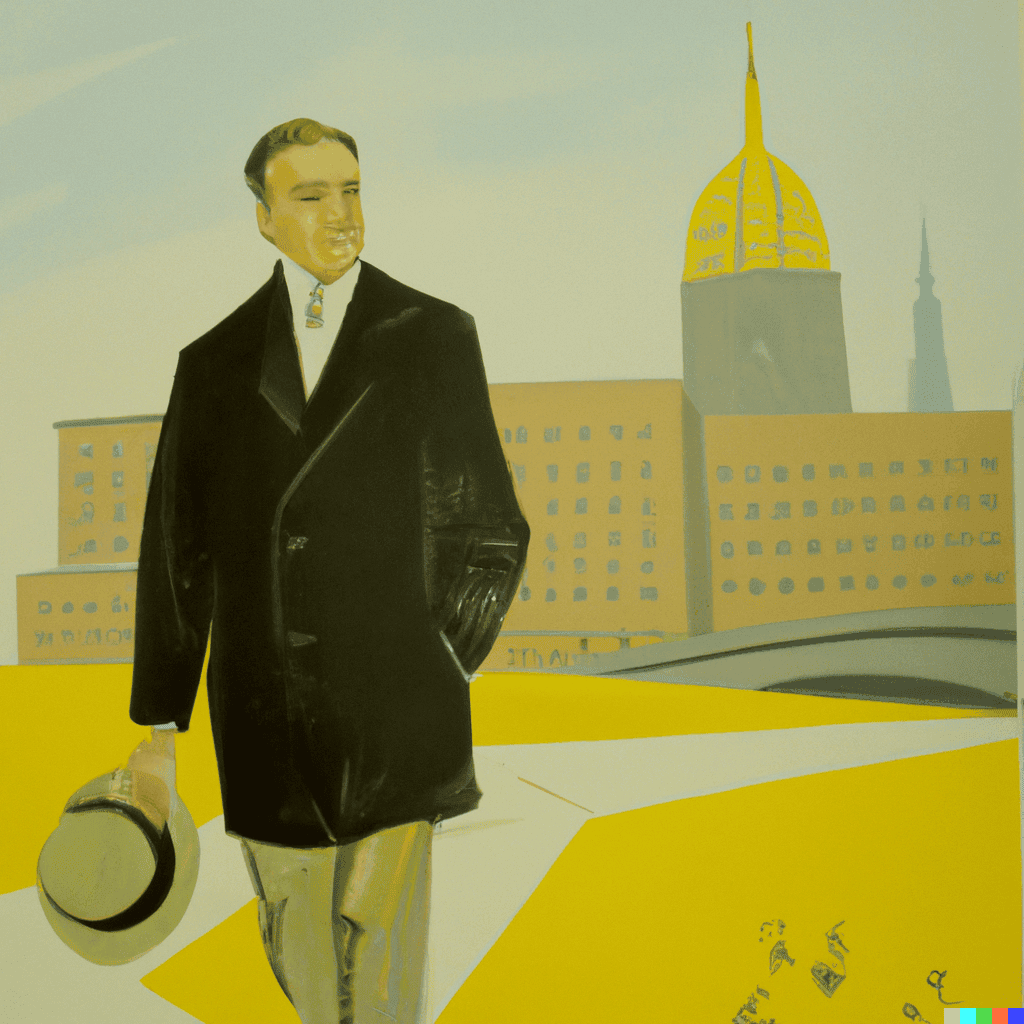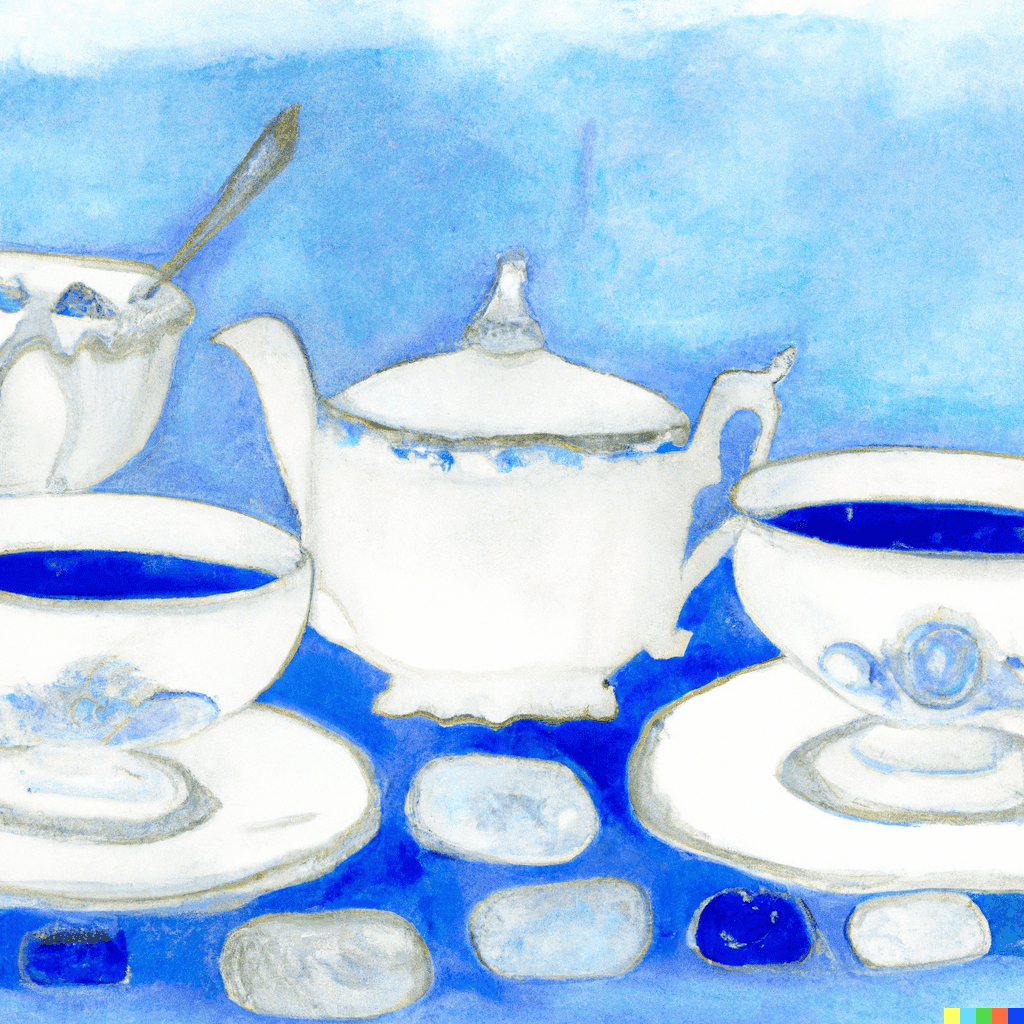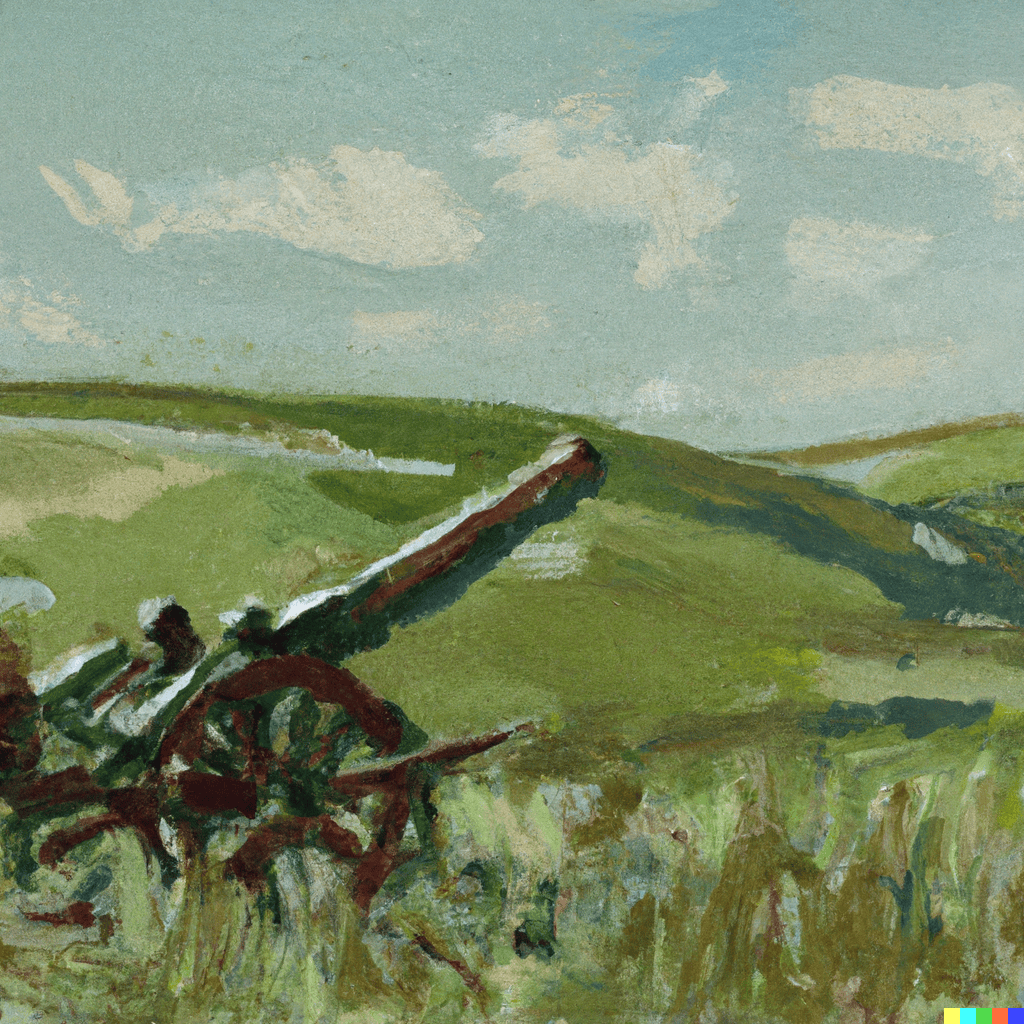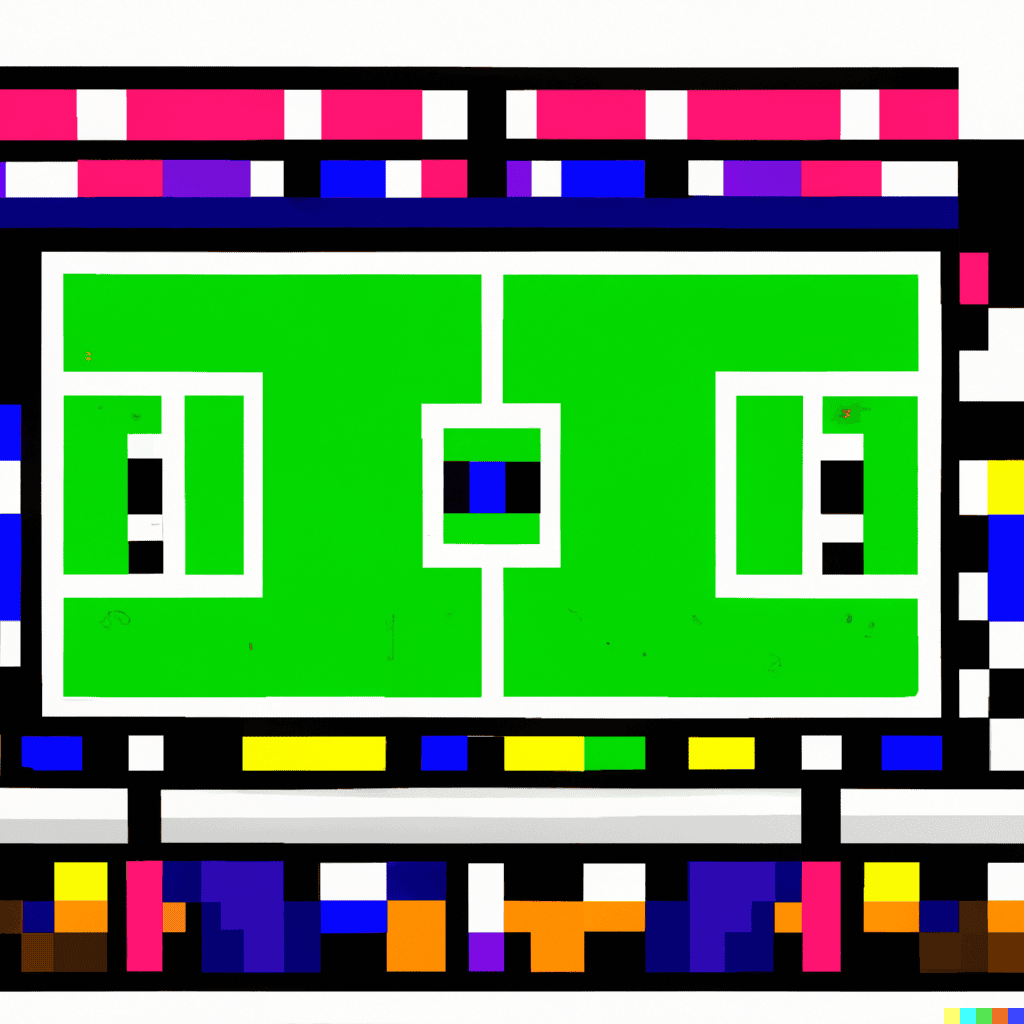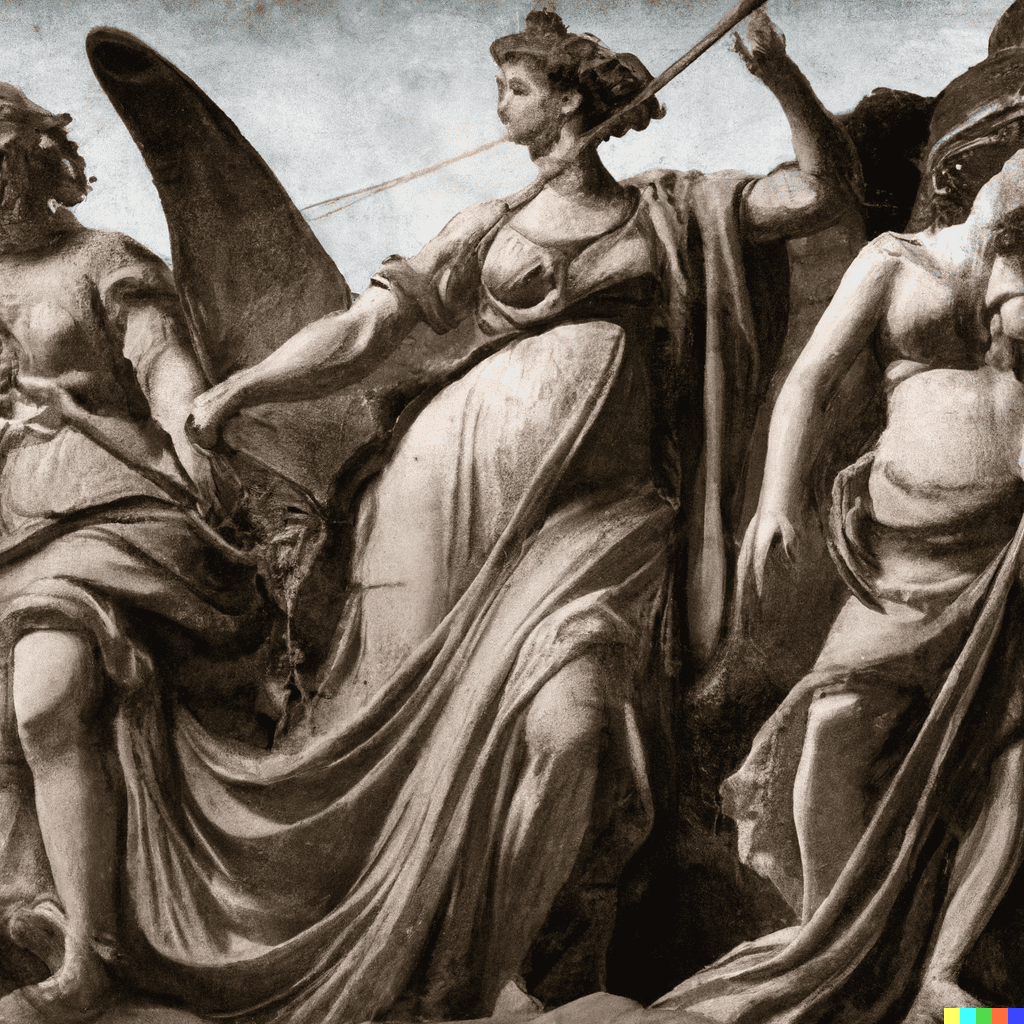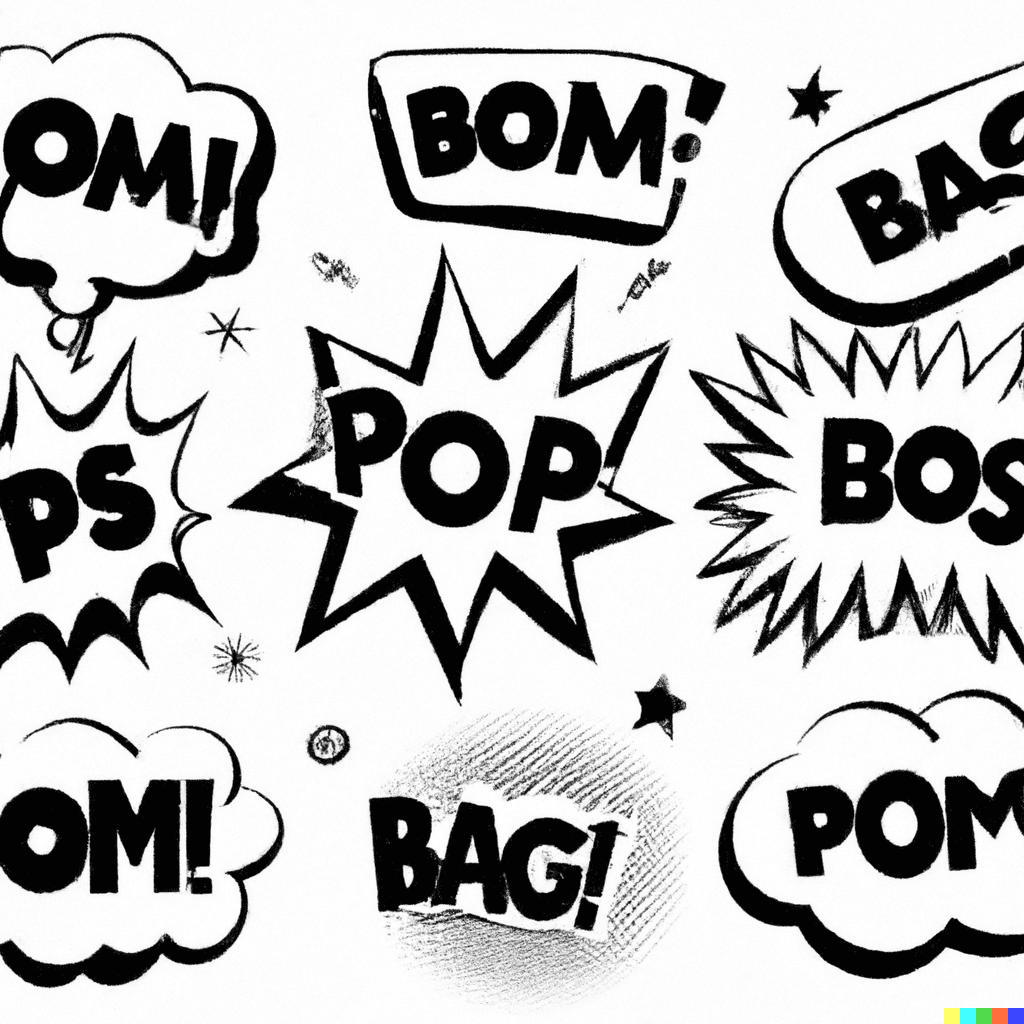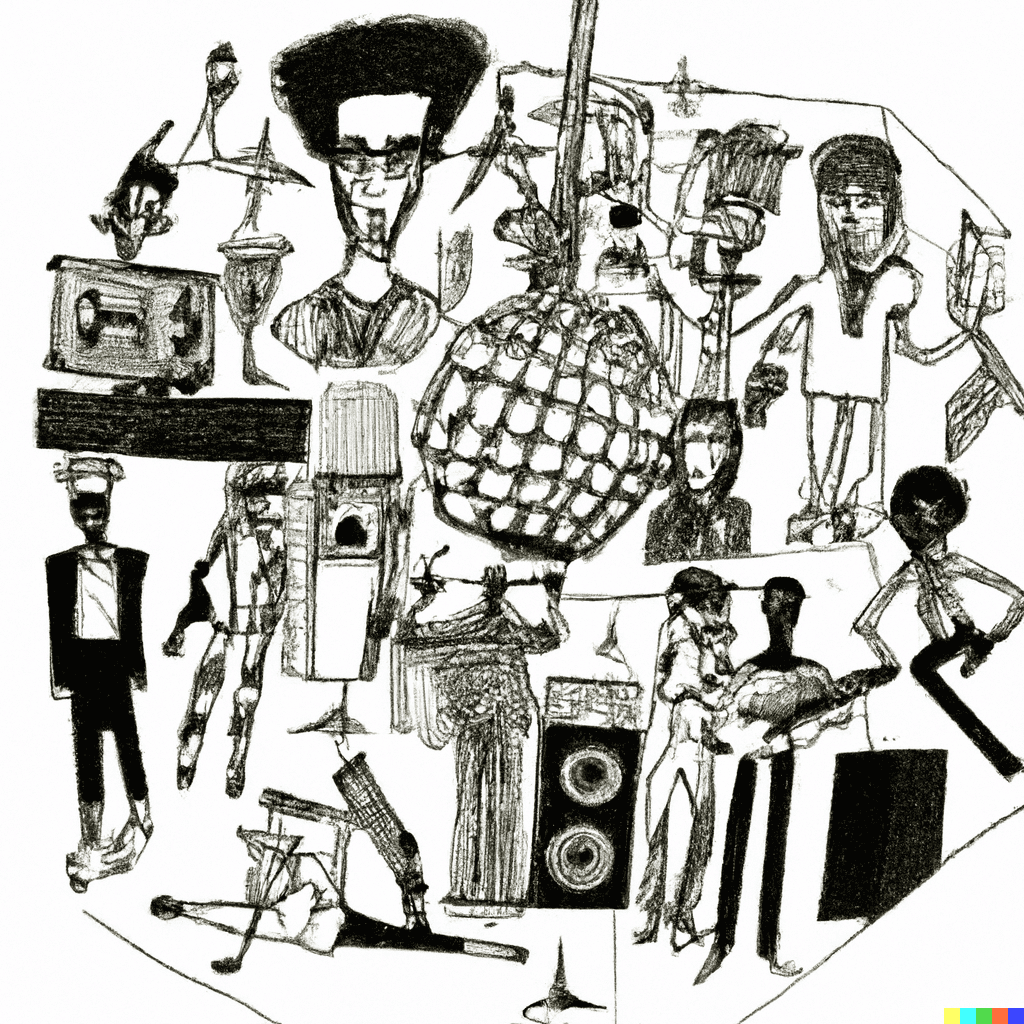Erfahrungen und deren Weitergabe bilden eine wesentliche Grundlage von immateriellem Kulturerbe (IKE). Auch in der Museumsarbeit spielen neben den (materiellen) Objekten die Dokumentation und Weitergabe von (immateriellen) Kenntnissen und Fertigkeiten, die mit dem Objektwissen verknüpft sind, eine wichtige Rolle. Die Befragung der 101 Museen, die für eine erste Bestandsaufnahme im Rahmen des Projektes „Materialisierung des Immateriellen?“ (zum Working Paper) durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass das Interesse am Austausch in den Häusern sehr groß ist – insbesondere hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung digitaler Angebote für die Vermittlung von IKE.
Hier werden die Erfahrungen und Ideen der Häuser im Zusammenhang mit verschiedenen Aspekten dieser digitalen Projekte zur Vermittlung von IKE präsentiert. Kolleg*innen aus vier Museen – dem Porzellanikon in Selb, dem Historischen Museum Frankfurt in Frankfurt am Main, dem Bach-Museum in Leipzig und dem Buddenbrookhaus in Lübeck – gaben tiefergehende Einblicke in ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit IKE und digitalen Vermittlungsangeboten.
Immaterielles Kulturerbe (IKE) lebt durch die Menschen, die es praktizieren – die Communities of Practice. Sie geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter und entwickeln es durch Praxis und Austausch stetig fort. Museen und ihre Mitarbeiter*innen können auch Akteur*innen in der Ausübung und in der Pflege von IKE sein.
Die Träger*innen und weitere Stakeholder*innen des IKE einzubeziehen, ist für die Museumsarbeit unverzichtbar, denn sie sind die Expert*innen. Nur mithilfe ihrer Kenntnisse und Erfahrungen kann IKE in seiner Vielfalt und Vielschichtigkeit im Museum gesammelt, dokumentiert, erforscht und präsentiert werden. Erfahrungen und Kenntnisse aus den gemeinsamen Entwicklungen von (digitalen) Projekten in den befragten Museen sind hier zusammengetragen.
Vielfalt anerkennen & leben
Die Menschen, Gruppierungen und Communities, die sich mit IKE befassen, es leben, pflegen und diskutieren, zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus. Das von den Museen berichtete Spektrum reicht von Laien über Autodidakt*innen bis hin zu hoch spezialisierten Expert*innen. Die Träger*innen sind als Einzelpersonen aktiv und/oder in Vereinen, Arbeitskreisen etc. ehrenamtlich engagiert; sie arbeiten in Unternehmen sowie Forschungs- und Bildungseinrichtungen, mitunter auch in den Museen selbst.
IKE-Akteur*innen bringen also unterschiedliche Hintergründe, Expertisen und Sichtweisen auf immaterielles Kulturerbe ein. Die Multiperspektivität, die aus der Zusammenarbeit verschiedener IKE-Akteur*innen entsteht, ist eine besondere Stärke.
Fazit:
Schauen Sie genau hin. Lernen Sie „Ihre“ Community/Communities of Practice kennen und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Bandbreite von Wissen, persönlichen Erfahrungen und Wünschen, um gemeinsam Projektideen zu entwickeln. Schaffen Sie bei der Entwicklung Ihrer Anwendung Raum für diese vielfältigen Potenziale. Je facettenreicher die Perspektiven, desto wertvoller für Ihre Anwendung.
IKE-Träger*innen einladen & unterstützen
Nicht alle Museen stehen in einem alltäglichen Kontakt mit IKE-Träger*innen. Deren Beteiligung an digitalen Projekten ist kein Selbstläufer. Gezielte Ansprachen sind daher häufig notwendig.
Die Formen der Beteiligung von IKE-Träger*innen und Träger*innengruppen können dabei sehr verschieden sein. Sie gehen von der inhaltlichen Beratung über die Erstellung digitaler Beiträge bis hin zur Beteiligung an der Konzeption und Entwicklung digitaler Projekte. Und auch die Art und Weise der Beiträge zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus.
Vielfältige Potenziale können sich entfalten, wenn die IKE-Träger*innen dabei unterstützt werden, sich aktiv zu beteiligen. Die Museen können hier ihr Wissen und ihre Fähigkeiten sowie Infrastruktur zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe die IKE-Träger*innen ihr immaterielles Erbe pflegen, präsentieren und weitergeben können.
Fazit:
Sprechen Sie die IKE-Träger*innen an und laden Sie sie ein, gemeinsam Projekte für die Pflege, Weitergabe und Vermittlung des immateriellen Kulturerbes zu entwickeln bzw. sich an IKE-Projekten zu beteiligen. Sehr verschiedene Formate können so entstehen. Schauen Sie dabei, wie Sie mit Ihrem Wissen, Ihren Erfahrungen und Fähigkeiten die IKE-Träger*innen in der Beschäftigung mit deren immateriellem Kulturerbe unterstützen können.
Kommunikation planen & gestalten
Offene und wertschätzende Kommunikation bildet die Grundlage für das Gelingen eines gemeinsamen IKE-Projektes. Insbesondere in kollaborativen Prozessen kommt es darauf an, Wissen sowie die „Deutungs- und Entscheidungshoheit“ zu teilen. In der Zusammenarbeit zwischen Museen und IKE-Träger*innen kann daher ein gewisses Konfliktpotenzial liegen, schließlich können sich das Verständnis von IKE sowie die Herangehensweisen und Zielsetzungen hinsichtlich der Pflege der kulturellen Ausdrucksformen unterscheiden. Dies sind Aushandlungs- und Lernprozesse für alle Beteiligten.
Der Austausch zwischen Museumsmacher*innen und IKE-Träger*innen braucht Aufgeschlossenheit, Transparenz, Vertrauen – und vor allem viel Zeit.
Gelingt es hier bei dem gesamten Prozess, das Museumskollegium mitzunehmen, indem es seinerseits mit seinen Expertisen möglichst früh und eng einbezogen wird, profitiert das gesamte Projekt.
Fazit:
Wertschätzende Kommunikation und die Moderation von Aushandlungs- und Lernprozessen sind essenziell für das Gelingen Ihres Projektes. Planen Sie den Austausch mit den IKE-Träger*innen sorgfältig, aber auch ergebnisoffen. Berücksichtigen Sie, dass eine Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit gegenseitiges Vertrauen ist, das aufgebaut werden muss. Das gilt sowohl für die Community of Practice als auch für die Mitarbeitenden im Museum. Nehmen Sie sich dafür ausreichend Zeit.
Museen sind Bindeglieder zwischen Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Als solche sind sie es gewohnt, Netzwerke zu pflegen: zu Ehrenamtlichen und Expert*innen, zu akademischen Einrichtungen in ihrem Themenfeld, zu potenziellen Geldgebern, zu Medien und Politik.
Eine Vielzahl der befragten Kolleg*innen in den Museen betonten, dass insbesondere im Kontext digitaler Vermittlung von IKE diese Netzwerke sehr wertvoll sind, da für diese Art von Projekten Know-how aus den verschiedensten Bereichen gebraucht wird. Ein Zusammenarbeiten mit weiteren Stakeholdern kann über inhaltliche und technische Aspekte hinaus auch auf programmatischen und institutionellen Ebenen einen Mehrwert erbringen.
Inhaltlich können neben den Praktiker*innen auch Akteur*innen aus der Forschung zur Pflege und Weitergabe von IKE beisteuern.
Technische Kenntnisse sind sowohl für die Vorbereitung und die Umsetzung von digitalen Projekten als auch für die Nutzung und Weiterentwicklung der digitalen Anwendung ein unverzichtbares Gut. Entwicklungspartnerschaften vereinfachen dies.
Darüber hinaus lohnt es sich für die Vermittlung von IKE im Digitalen, aber auch im Analogen, ein breites und vielfältiges Fundament auch mit anderen Institutionen zu schaffen.
Fazit
Das IKE lebt durch die Vielfalt seiner Praktiken sowie Wissensebenen und -systeme. Bauen Sie einen möglichst vielseitigen Gesprächskreis und Netzwerke auf, um verschiedene Perspektiven einbeziehen zu können. Neben den gemeinschaftlichen inhaltlichen Erarbeitungen suchen Sie sich auch Partner, mit denen Sie insbesondere technische Prozesse gemeinsam im Austausch entwickeln können.
Externe erreichen
Museen wollen aber nicht nur Museumsmacher*innen und IKE-Expert*innen zusammenbringen, sondern auch und vor allem Orte sein, an denen Menschen ohne Vorwissen mit IKE in Kontakt kommen und begeistert werden für die Besonderheiten der kulturellen Ausdrucksformen sowie für die Praktiken und Menschen, die IKE leben und weitergeben. Um das Interesse der sogenannten „IKE-Externen“ an immateriellen Kulturformen zu wecken, können digitale Anwendungen als Brücke dienen.
Über Schulen und Freizeiteinrichtungen können vor allem junge Menschen erreicht werden.
Die Frage, wie man das Interesse der jüngeren Generationen weckt, ist nicht nur für Museen eine große Herausforderung. Auch im Kontext von IKE ist es nicht immer leicht, den Nachwuchs zu begeistern.
Fazit
IKE muss beständig ausgeübt, diskutiert und weitergegeben werden, um lebendig zu bleiben. Sichtbarkeit und Verständnis sind zentral, damit Menschen in jeder Generation aufs Neue einen Umgang mit IKE finden. Es ist wichtig, dass Sie die Interessen und Bedürfnisse Ihres Publikums und insbesondere Ihrer jüngeren Besucher*innen im Blick haben, wenn Sie Angebote entwickeln, um IKE erfahrbar zu machen.
Die Möglichkeiten der digitalen IKE-Vermittlung in Museen sind eine zentrale Fragestellung des Projekts „Materialisierung des Immateriellen?“. Was also sind die Chancen und welche Herausforderungen gibt es? Welche Vermittlungskonzepte funktionieren und welche Medien bieten sich wofür an? Welchen Mehrwert hat die digitale Vermittlung für das Museum, die Nutzer*innen und die IKE-Akteur*innen? Dazu mehr im Folgenden.
Viele der von uns befragten Museumskolleg*innen arbeiten engagiert daran, immaterielles Kulturerbe möglichst attraktiv zu präsentieren. Sie sind überzeugt: Digitale Anwendungen helfen dabei, ein Thema besser und anders zu verstehen und stärker zu verinnerlichen.
Dabei gilt: Je unmittelbarer die Erfahrungen und Kenntnisse vermittelt werden, desto größer der Reiz.
Immaterielles Kulturerbe ist per se komplex und vielschichtig und wirkt auf mehreren Ebenen. Ein museales Vermittlungsangebot muss daher ganz unterschiedliche Zugänge zu den Themen und Inhalten anbieten und unterschiedliche Vorkenntnisse berücksichtigen. Digitale Angebote haben hier großes Potenzial, da sie unterschiedliche Medialitäten zusammenführen und über unterschiedliche Kanäle genutzt und abgerufen werden können.
Ein großer Vorteil digitaler Inhalte liegt in ihrer einfachen und kostengünstigen Reproduzierbarkeit. Viele Museen legen ihre digitalen Anwendungen von vornherein so an, dass sowohl Technik als auch Inhalte (Content) mehrfach verwendet werden können.
Einen weiteren Mehrwert digitaler Anwendungen sehen einige der Befragten auch in der Automatisierung von Abläufen, die Effizienzgewinne ermöglicht. Wo Wissen per App oder Computerspiel anstatt durch eine*n Museumsmitarbeiter*in vermittelt wird, ist das Museum räumlich, zeitlich und personell flexibler.
Wenn man die Wiederverwendung und Nachnutzung einer digitalen Anwendung plant, sollte man immer die Frage nach den Urheber- und Nutzungsrechten bedenken:
Immaterielles Kulturerbe vermittelt sich vor allem in der Praxis – durch die Menschen, die Wissen und Fähigkeiten vorleben. Live-Veranstaltungen, wie zum Beispiel Vorführungen oder Workshops im Museum, sind durch nichts zu ersetzen – doch fallen diese aus, wenn der Glasbläser zum gegebenen Termin krank ist. Und sie bleiben in ihrer Wirkung begrenzt, wenn Menschen – aus welchen Gründen auch immer – nicht zur gegebenen Zeit vor Ort sein können. In der Unabhängigkeit von Zeit und Ort liegt deshalb eine große integrative Kraft digitaler Vermittlung.
Barrierefreiheit und Inklusion sind Themen, die auch im Digitalen von Anfang an mitgedacht werden sollten – sowohl bei den Inhalten und der Gestaltung als auch bei der Technik.
Die breite Sichtbarkeit und Zugänglichkeit ermöglicht es, Menschen auf das Angebot aufmerksam zu machen, an die ursprünglich niemand dachte. Meistens wird die Anwendung dann auch noch zu völlig neuen interessanten Zwecken eingesetzt – ein häufiges Phänomen im digitalen Raum.
Ein besonderes Potenzial digitaler Anwendungen wird darin gesehen, dass sie als Verbindungsglied zwischen verschiedenen Orten dienen können.
Zahlreiche Museen schaffen mit ihren digitalen Anwendungen Querbezüge zwischen authentischen Orten in der Stadt (draußen) und dem Ausstellungsraum im Museum (drinnen), indem sie Informationen im Außenraum digital per QR-Code oder in einer App verfügbar machen.
Die sinnvolle Verbindung der digitalen Anwendungen mit analogen Angeboten wird dabei von den Befragten immer mit bedacht.
Natürlich hat die digitale Vermittlung von IKE ihre Grenzen.
Viele Museumsmacher*innen, insbesondere wenn sie eng mit IKE-Träger*innen kooperieren, sind der Auffassung, lebendige Erlebnisse vermittelten sich am besten vor Ort und im direkten Austausch.
Ein wichtiger didaktischer Vorteil von Präsentationen vor Ort: Man kann dem Museumspersonal, häufig selbst IKE-Akteur*innen, Fragen stellen. Bei digitaler Vermittlung, beispielsweise per Livestream, klappt dieser Dialog nach den Erfahrungen der Befragten nur sehr eingeschränkt.
Auch digitale Angebote im Stadtraum funktionieren nicht von selbst.
Die Nutzung digitaler Anwendungen, aber auch interaktive und partizipative Ansätze digitaler Angebote sind also keine Selbstläufer.
Fazit
Digitale Anwendungen vervielfältigen die Möglichkeiten, um IKE in seiner Vielfalt und Vielschichtigkeit zu dokumentieren und zu vermitteln. Sie können auf diese Weise ein vielstimmiges Vermittlungsangebot schaffen, das über die vier Wände sowie über das traditionelle Publikum Ihres Museums hinausgeht. Nutzen Sie die Potenziale, um das IKE und Ihre Museumsarbeit in einem größeren Kreis und auf verschiedenen Ebenen sichtbar zu machen. Und nutzen Sie verschiedene Räume und Orte, um Interesse und Neugierde für Ihre Inhalte, Ihre Arbeit und Ihr Museum zu wecken. Haben Sie keine Angst, dass mit der digitalen Vermittlung das Publikum nicht mehr kommt; die digitalen Angebote können das spezifische Museumserlebnis – den gemeinschaftlichen Umgang mit Menschen, Themen, Ideen, Objekten vor Ort – nicht ersetzen, aber erweitern.
Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten und digitale Angebote werden sich in Museen zukünftig ebenfalls weiterentwickeln. Einige Museen denken daher von Anfang an in größeren Maßstäben. Sie sehen die jeweilige Einzelanwendung nicht als abgeschlossene Einheit, sondern als Fundament, auf das man in späteren digitalen Projekten aufbauen kann und das eine Weiterentwicklung und Nachnutzung ermöglicht. Damit das gelingt, sind einige Voraussetzungen zu erfüllen und Hürden zu nehmen.
Um einmal entwickelte Anwendungen nachhaltig nutzbar zu machen, lohnt es sich, eine technische Infrastruktur frühzeitig aufzubauen, denn sie kann die Hauptaufgaben des Museums, also das Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln, übergreifend unterstützen, wenn sie strategisch geplant wird.
Solche Gedanken entstehen allerdings selten vorab in einem geplanten Prozess, sondern ergeben sich eher in einem laufenden Projekt. Plötzlich wird erkannt, dass sich mit demselben technischen System mehrere Bedarfe abdecken lassen. Ein Beispiel ist das Content-Management-System im „Stadtlabor Digital“ im Historischen Museum Frankfurt (Frankfurt/Main): Eigentlich gedacht als Medium zum Ausspielen (= Vermitteln) von Inhalten, wurde bei der Entwicklung der Anwendung erkannt, dass mithilfe des CMS auch die Beiträge von IKE-Träger*innen gesammelt und dokumentiert werden können.
An diesem Fall wird außerdem deutlich: Die in Museen präsentierten Sammlungsgüter werden zunehmend selbst digital. Die Sicherung und strukturierte Dokumentation digitaler Inhalte ist also eine wichtige anstehende Aufgabe für Museumsmacher*innen. Wo es früher darum ging, Dokumente aus feuchten Kellern zu retten und sie zu erhalten, müssen jetzt Datensammlungen gesichert werden – sei es von privaten Festplatten oder von öffentlichen Internetportalen. Wer vielfältig vermitteln will, muss auch vielfältig dokumentieren – und dafür braucht es Konzepte und eine technische wie personelle Infrastruktur.
Ko-Kreation mit Gestaltern & IT-Entwicklern
In der digitalen Vermittlung spielt Technologie per Definition eine wichtige Rolle. In kaum einem Museum sind die personellen Kapazitäten und Kompetenzen vorhanden, ein solches Projekt allein zu stemmen. Daher werden externe Dienstleister aus der Kreativ- und IT-Branche sehr oft hinzugezogen. Diese schon sehr früh einzubinden, wird als ein Schlüssel zum Erfolg gesehen.
Welche Technik wählen?
Bei der Wahl der passenden Anwendung gibt es eine Vielzahl an Erwägungen. So sind die Erwartungen und Gewohnheiten des Publikums von zentraler Bedeutung für die Durchführung eines digitalen Projektes.
Und auch die IKE-Akteur*innen haben mit Blick auf die Vermittlung ihrer kulturellen Ausdrucksformen Erwartungen an die Form und Qualität.
Beim Streben nach dem Wünschenswerten sollte das Machbare nicht aus den Augen geraten. Mindestens ebenso wichtig wie die Frage „Was will die Zielgruppe?“ ist die Überlegung „Was können wir leisten? Welche Ressourcen haben wir?“.
Open-Source-Entwicklungen können hier helfen.
Auch technische Aspekte müssen bereits in der frühen Phase berücksichtigt werden, damit die Anwendung dann in der gewünschten Weise verwendet werden kann.
Usability-Testing
Sind erste Überlegungen zum Konzept und zur Technik der Anwendung gemacht, kann es helfen, diese nochmals zu hinterfragen und zu überprüfen – am besten mit verschiedenen Beteiligten – Museumsmitarbeiter*innen, IT-Dienstleister*innen und insbesondere den Nutzer*innen.
In digitalen Projekten sind User-Tests mit Prototypen inzwischen Standard – und sie werden von den befragten Museen auch empfohlen. Einerseits, um sinnvolle Features von weniger geeigneten abzugrenzen:
Andererseits auch, um technische Probleme zu identifizieren.
Begleitende Kommunikation
(Kooperative) digitale Projekte sind sehr kommunikative Prozesse. Der stetige Austausch zwischen den verschiedenen Beteiligten ist fundamental, speziell bei „agilen“ Projekten, bei denen kontinuierlich darauf geachtet werden muss, dass die gemeinsam gesteckten Ziele erreicht werden.
Auch die (potenziellen) Nutzer*innen sollten auf vielfältige Weise in den Entstehungsprozess eingebunden werden. Neben den Usability-Tests lohnt es sich, Interesse für das Projekt zu wecken und stetig über den Fortgang der Entwicklung zu informieren. Auf diese Weise kann auch die Museumsarbeit selbst transparent präsentiert werden.
Museumsmitarbeiter*innen unterstrichen, dass die Kommunikation auch nach der Bereitstellung der Anwendung fortzuführen sei, um so das Publikum auf die erweiterten Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Gerade bei komplexen oder auch fragilen Angeboten erweist es sich als hilfreich, unterstützendes Personal für die Betreuung der Anwendung einzuplanen.
Digitale Anwendungen haben Entwicklungskosten, aber sehr häufig auch Folgekosten. Kaum ein Hinweis wurde von den befragten Museen so häufig gegeben wie der, den Betreuungs-, Wartungs- und Weiterentwicklungsaufwand digitaler Anwendungen nicht zu unterschätzen.
Ein Spiel, das im App-Store steht, muss auf dem neuesten Stand gehalten werden. Sonst funktioniert es nicht mehr oder wird sogar vom Betreiber des App-Stores entfernt. Ein Content-Management-System braucht regelmäßige Aktualisierungen, sonst ist die Datensicherheit gefährdet.
Weiterentwicklung ist für den Erfolg digitaler Museumsprojekte ein wichtiges Stichwort. Denn im Grunde ist die Entwicklungsfähigkeit geradezu ein Wesensbestandteil des Digitalen. Allerdings gibt es im Museumskontext aktuell zahlreiche Hindernisse, die den Fortschritt insgesamt verhindern oder zumindest verlangsamen.
Regulatorische Hürden
Gesetzliche Vorgaben, sei es zum Datenschutz oder zu Förderrichtlinien, können die gewünschte Weiterentwicklung erheblich erschweren:
Technische Hürden
Die rasante technische Entwicklung im Digitalbereich macht es zur Herausforderung, Anwendungen aktuell zu halten oder sogar weiterzuentwickeln. Noch schwieriger wird es, wenn man mit externen Partnern arbeitet, die nach Projektende nicht mehr zur Verfügung stehen.
Selbst wenn es gelingt, Fachkenntnisse intern aufzubauen, können Eigenleistungen auch an der technischen Ausstattung scheitern.
Auch die Ausstattung der Nutzer*innen ist ein einschränkender Faktor für den Projekterfolg:
Finanzielle Hürden
Je komplexer die Technik, desto personalintensiver und kostenaufwendiger sind Wartung und Weiterentwicklung. Deshalb empfehlen viele Museumskolleg*innen, die Anwendungen einfach und überschaubar zu halten.
Fazit
Die digitalen Technologien erbringen für die Vermittlung vielfältigste Möglichkeiten. Nutzen Sie bei der Planung Ihres digitalen Projektes das technische Know-how von IT-Expert*innen. Digitale Entwicklungen sind zumeist aufwendiger, als sie erscheinen. Planen Sie daher Zeit für Konsultationen, den Austausch und für Testdurchläufe ein. Und haben Sie unbedingt auch die Nutzung und Pflege Ihres digitalen Angebots sowie die Möglichkeiten der Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung bei Ihrer Planung im Blick – nicht nur aus finanzieller, sondern auch aus personeller Perspektive.
Die Umsetzung digitaler Projekte im Museumskontext ist komplex und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Hier kommt das Projektmanagement ins Spiel, das einen strukturierten Ansatz für die Verwaltung digitaler Projekte bietet und sicherstellt, dass diese pünktlich, innerhalb des Budgets und in der gewünschten Qualität durchgeführt werden.
In eigentlich jedem Kommunikationsprojekt ist es sinnvoll zu fragen, was die Zielgruppe wünscht und erwartet und welche Art der kommunikativen Vermittlung sich anbietet. Je gründlicher diese Analyse des Marktumfeldes ausfällt – zum Beispiel bezogen auf die Altersstruktur der Besucher*innen, ihre Vorlieben und Verhaltensweisen –, desto besser.
Doch sollte der Blick nicht auf das Museumspublikum begrenzt bleiben. Eine besonders wertvolle Ressource in IKE-Projekten sind die IKE-Träger*innen. Sie frühzeitig mit einzubinden und nach ihren Erfahrungen mit der IKE-Vermittlung zu befragen, kann sehr wertvoll sein.
Neben dem Finanziellen ist Zeit die Ressource, mit der im Projektmanagement sehr bewusst geplant werden muss, gerade in Digitalprojekten. Sehr häufig hörten wir, dass Dinge länger dauern, als ursprünglich gedacht.
Ein Weg damit umzugehen ist es, den Qualitätsanspruch, und damit den Aufwand, pragmatisch anzugehen.
Gerade das Beispiel des Porzellanikons zeigt: Wo digitale Formate eher Werkstattcharakter haben, erwarten die Nutzer*innen keine technologischen Wunder. Hier ging es darum, in einer Pandemiesituation ad hoc alternative Präsentationsformen zu finden, um dem Publikum überhaupt etwas bieten zu können. Inwieweit das auch in einer Zukunft funktionieren wird, in der wegen immer besser werdender digitaler Angebote im kommerziellen Bereich auch im Museumskontext die Erwartungen steigen dürften, bleibt abzuwarten. Wichtig bleibt, sich über Ziele und Strategien der eigenen Digitalprojekte klar zu werden und damit transparent umzugehen.
Eine wichtige Aufgabe innerhalb des Projektmanagements ist es, die Kosten im Blick zu behalten. Dazu gehören die Budgetplanung sowie das Anzapfen möglicher Finanzierungsquellen.
Fördertöpfe nutzen
Öffentliche Förderprogramme sind ein wichtiger Faktor zur Finanzierung von Museen. Ohne diese, so hörten wir immer wieder, hätte es viele der hier dargestellten Anwendungen und Projekte nie gegeben.
Gelder für digitale Museumsprojekte sind also in durchaus relevantem Umfang vorhanden.
Die Herausforderung für die Museen besteht jedoch darin, dass die Förderprogramme meist eine besondere Zielrichtung und sehr spezifische Zugangsvoraussetzungen haben, denen entsprochen werden muss. Es kommt also darauf an, Richtlinien genau zu lesen und die Förderanträge exakt darauf anzupassen.
Womöglich muss das eigene Projekt in seiner Ausrichtung sogar leicht verändert werden, um förderfähig zu sein. So kann ein Spannungsverhältnis zwischen einem vorgegebenen Ziel bzw. gewünschten Ergebnis auf Seite der Förderer und dem Wunsch nach einem ergebnisoffenen, kreativen Prozess auf Museumsseite entstehen.
Ressourcen & ehrenamtliches Engagement
Wenn es um Mittelakquise geht, wird ein Aspekt gern übersehen: Durch das Know-how vor Ort in den Museen sowie durch das Engagement von Ehrenamtlichen, oft selbst IKE-Träger*innen, lassen sich Kosten mitunter in relevantem Umfang einsparen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen kann hier sehr hilfreich sein.
Einbeziehung von Beteiligten/Expert*innen
Im Kapitel Community-Arbeit wurde bereits erläutert, wie wichtig es in digitalen IKE-Projekten ist, die Communities of Practice und IKE-Träger*innen einzubeziehen. Dort wurde erwähnt, dass es ohne externe Expert*innen wie Mediengestalter*innen und IT-Fachkräfte, die bei der Umsetzung helfen, nicht geht. Daraus erwachsen wiederum Aufgaben für das Projektmanagement, denn diese Integrationsprozesse kosten Zeit.
Stetige Evaluierung
Zu einer guten Projektleitung gehört heute auch die rückblickende Bewertung des Geleisteten. Welche Ziele wurden erreicht, welche verfehlt? Was hat sich bewährt und was sollte in Zukunft anders laufen? Meilensteinplanung, Schulterblicke, Retrospektiven und Projektreviews sind hier die Methoden der Wahl, die zunehmend auch im Museumsbereich Anwendung finden.
Fazit
Die Koordination ist zentral für das Gelingen von Projekten: Der*Die Ansprechpartner*in ist für alle Beteiligten die Zentrale für den gemeinsamen Austausch. Bei ihm*ihr laufen die verschiedenen Fäden zusammen und es wird sowohl der Überblick über die einzelnen Wünsche, Aufgaben und Arbeitsphasen gewahrt, als auch das gemeinsame Ziel in den Blick genommen.
Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Befragung noch einmal übersichtlich zusammengefasst – als Fazit oder schneller Überblick für Menschen mit wenig Zeit.
Wenn Sie gerade Ihr erstes digitales Projekt starten: Gehen Sie davon aus, dass weitere folgen werden. Es wird sich auszahlen, von Anfang an strategische Ziele zu definieren sowie Strukturen und Ressourcen aufzubauen, die Sie auch in Zukunft nutzen können.
Mut zum ersten Schritt
Die Ausnahmesituation der Pandemie hat gezeigt, wie mit Kreativität, Pragmatismus und digitalen Mitteln neue Zugänge zum immateriellen Kulturerbe entstehen können. Lassen auch Sie sich auf dieses Abenteuer ein. Das Digitale bietet Raum zum Experimentieren und die Chance, flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen einzugehen.
Ganzheitlich denken
Sammlungsgüter stehen zunehmend digital zur Verfügung – als digitalisierte und „Born digital“-Objekte. Außerdem wird der Umgang mit den entsprechenden Inhalten und Endgeräten für das Museumspublikum immer selbstverständlicher. Verstehen Sie Ihre Digitalprojekte deshalb nicht als bloße Ergänzung, sondern als integralen Teil der Gesamtstrategie Ihres Museums.
Über den Tellerrand blicken
Mit digitalen Anwendungen besteht die Chance, Menschen auch jenseits der klassischen Museumsklientel und an anderen Orten zu erreichen, zum Beispiel im öffentlichen Raum oder zu Hause. Werden Sie aktiv, um den Wirkungskreis Ihres Museums zu erweitern und ein neues Publikum zu erschließen.
Die Arbeit im Museum wandelt sich. Auf das Personal kommen neue Aufgaben und Arbeitsweisen zu – auf mehreren Ebenen. Hier gilt es, die Mitarbeiter*innen mitzunehmen und einzubinden.
Informieren
Wer die Richtung nicht kennt, bleibt orientierungslos und kann weder nach innen noch nach außen erfolgreich wirken. Deshalb braucht es von Anfang an eine offene und transparente interne Kommunikation.
Technisch qualifizieren
Digitale Anwendungen sind selten selbsterklärend. Gerade ältere Besucher*innen benötigen oft Unterstützung oder zumindest einen Anstoß, sich auf die Technik einzulassen. Um helfen zu können, müssen die Mitarbeiter*innen vor Ort die Technik erst einmal selbst verstehen.
Sozial schulen
Museen entwickeln sich weg von der reinen Wissensvermittlung, hin zu Erlebnis- und Begegnungsorten. Wo Dialog und Partizipation zunehmen, muss das Personal dazulernen und sein Kommunikationsverhalten gegebenenfalls anpassen.
Langfristig aus- und weiterbilden
Neue Vermittlungswege und Kommunikationsformen brauchen andere Kompetenzen. Darauf sollten sich Museen nicht nur anlässlich aktueller Projekte einstellen, sondern längerfristig entsprechende Maßnahmen der Personalentwicklung ergreifen.
Nicht nur die eigenen Mitarbeiter*innen sollten im Bilde sein, wenn digitale Projekte zur Vermittlung von IKE anstehen. Idealerweise werden auch Externe frühzeitig informiert.
IKE-Träger*innen einbeziehen
In digitalen IKE-Projekten ist es ratsam, so früh wie möglich IKE-Träger*innen ins Boot zu holen. Dabei offen, transparent und auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist entscheidend. Denn ohne diejenigen, die das jeweilige Erfahrungswissen kennen und leben, geht es nicht.
Potenzielle Nutzer*innen befragen
Auf die Zielgruppen zuzugehen und deren Bedürfnisse und Erwartungen abzufragen, hat sich sehr bewährt. Eine frühzeitige Bedarfsanalyse verhindert Fehlinvestitionen und damit verbundenen Frust.
Publikum animieren
Digitale Anwendungen sind keine Selbstläufer. Gerade bei Formaten, die auf Interaktion setzen, müssen die Besucher*innen oft mit erhöhtem Aufwand zum Mitmachen bewegt werden. Das braucht Personal und womöglich eigene Marketingmaßnahmen.
Digitale IKE-Projekte sind divers und dynamisch. Hier treffen Menschen mit verschiedenen Rollen, Sichtweisen und Zielen aufeinander. Sie bringen unterschiedliches Vorwissen mit und lassen in der Zusammenarbeit neues Wissen entstehen. Auf Museumsseite ist Offenheit in alle Richtungen gefragt, um alle Perspektiven im Sinne des gemeinsamen Projekterfolgs einzubeziehen.
Offenheit gegenüber IKE-Communities
Die Träger*innen des immateriellen Erbes haben naturgemäß eine sehr spezifische Sicht auf ihr Thema und formulieren diese oft in ganz eigener Sprache. Diese Stimmen anzuhören und Subjektivität zuzulassen, zahlt sich aus.
Offenheit für technische Themen
Wenn IT-Entwickler*innen, Hard- und Software-Expert*innen frühzeitig im Boot sind, Bedenken äußern und selbst Wege aufzeigen können, steigt die Wahrscheinlichkeit auf ein stabiles digitales Produkt erheblich.
Offenheit im Prozess
Das Prinzip der „Agilität“ ist in der Softwareentwicklung heute fest etabliert. Es trägt der Erfahrung Rechnung, dass in unserer komplexen Welt Anforderungen immer seltener vorab definiert werden können. Stattdessen muss in Projekten mehr experimentiert und ein Kurswechsel oder gar Scheitern von vornherein eingeplant werden. Das ist herausfordernd, gerade in einem Umfeld, wo das Vergaberecht klare Anforderungskriterien vorschreibt. Wenn irgend möglich, sollten Ausschreibungen dennoch flexibel formuliert werden, sodass auf Erkenntnisse im Projektprozess reagiert werden kann und auch Finanzmittel bedarfsorientiert eingesetzt werden dürfen. Denn zu starre Zielvorgaben verengen den Spielraum für Erkenntnisgewinn und Entwicklung.
Offenheit gegenüber Museumskolleg*innen
Am Rande der Interviews war immer wieder zu hören: Ein intensiverer kollegialer Austausch ist wünschenswert, damit Museumsmacher*innen voneinander lernen können, denn Ideen und Ziele sowie gemeinsame Lösungsansätze oder auch Projekte können so gemeinsam erdacht werden.
Das Institut für Museumsforschung möchte mit dieser Website einen Beitrag leisten, den Austausch aufzunehmen. Anknüpfungspunkte gibt es zur Genüge.
Wenn Sie Kontakt zu Kolleg*innen suchen, finden Sie die Kontaktdaten auf den Detailseiten der beteiligten Häuser. Melden Sie sich gern bei uns, wenn Sie eigene Erfahrungen und Gedanken zu dieser Website beitragen möchten.